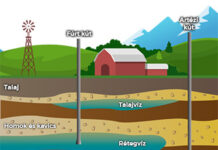Pfarrer Peter Fischer (Name geändert) hadert mit seiner Kirche – er sah sich von Gemeindemitgliedern als Servicekraft missbraucht. Er bat seine Obrigkeit um ein Jahr Sonderurlaub und zog danach in eine andere Ecke des Landes, weg aus der Kleinstadt.
Drei Jahrzehnte lang
hatte der Theologe als katholischer Priester in Kirchengemeinden seiner Diözese gearbeitet, Predigten gehalten, zahllose Kinder getauft, hunderte Paare getraut. Nun aber, im Alter von 55 Jahren, hat er sich für einen Schnitt entschieden. Am Ostermontag gab er sein Amt als Pfarrer mehrerer Gemeinden mit zehntausend Gläubigen auf.
Fischer will in der Abgeschiedenheit nachdenken, über seinen Beruf und sein Leben. „Mein Terminkalender ist komplett leer”, sagt er. „Es kommt ein Jahr zum Nachdenken…“Klar ist Fischer nur, was er nicht mehr will – weitermachen wie bisher.„Ich habe den Glauben daran verloren, dass der Weg, auf dem ich als Gemeindepfarrer mit Freude und Engagement gegangen bin, ein zukunftsweisender ist.“ Zeit seines Lebens habe er immer wieder erleben müssen, dass die Kirche an Bedeutung verliere. Und inzwischen fehle ihm die Hoffnung, dass sich dies bis zu seinem Tod ändern könnte.
Weil ihm also nach 30 Jahren in seinem Beruf die Perspektive abhanden gekommen sei, habe er seinen Bischof gebeten, ihn von seinem Amt zu entbinden.
Dass katholische Priester ihren Job aufgeben,

Sein Abgang sei keine Spontanreaktion gewesen, sondern das Ergebnis einer nüchternen Bilanz.
Peter Fischer ist in einem donauschwäbischen/ungarndeutschen Dorf aufgewachsen. Die alte Mundart war in der Familie lebendig, und der junge Pfarrer hoffte, nach dem politischen Wechsel in Ungarn die deutsche Messen- und Predigtsprache einführen bzw. pflegen zu können. Die Sprache ist aber ebenso schnell verschwunden, wie das religiöse Bewusstsein der nachfolgenden Barbie-Generation. Hinzu kommt, dass sich in seinen zahlreichen Gemeinden selbst mit ungarischer Gottesdienstsprache nicht einmal einige Dutzend Gläubige vor dem Altar versammeln lassen. Wie wäre das erst mit einer fast ausgestorbenen Minderheitensprache?
Als Peter Fischer 1980 sein Theologiestudium begann, stand es nicht schlecht um die Kirche, erinnert er sich: „Damals hieß es, die Nachwuchszahlen bei den Priestern gingen bergauf.” Heute sind mehr als 90 Prozent seiner Gemeindemitglieder Karteileichen. Sie zahlen Kirchensteuer, er sieht sie vielleicht auf der Straße, aber niemals im Gottesdienst. Wenn jedoch ein Ereignis wie die Geburt eines Kindes oder eine Hochzeit anstehe, so der Theologe, „dann erinnern sie sich an die Tradition”. Die kirchliche Feier müsse dann freilich serviceorientiert, fehlerlos und auf hohem Niveau „geliefert” werden.
Der Kirche aber bringe diese Brauchtumspflege wenig.
Bei der Taufe etwa würden die Eltern versprechen, ihre Kinder katholisch zu erziehen. Wenn diese aber später tatsächlich beten wollen, hören sie von eben diesen Eltern womöglich: „Lass den Quatsch.“

Doch womit könnte man im Rahmen der christlichen Kirchen einen Anreiz zur Entfaltung religiösen Lebens bieten? Als besondere Vergeudung von Ressourcen betrachtet der Geistliche die Feier der Erstkommunion, ein Ritus, der in katholischen Gegenden immer noch einen wahren Hype auslöst. Selbst kirchenferne Eltern schicken ihre Kinder vorher zum Kommunionsunterricht und den Sonntagsgottesdiensten. „Für die Kinder aber bekommt unser christliches Fest der Befreiung eine ganz eigene Bedeutung: Für sie ist es die Befreiung von der Pflicht, weiter in die Messe gehen zu müssen”, so Fischer.
Vor zwei Jahren wollte der Pfarrer die Feier in ihrer bisherigen Form abschaffen. Ohne Schulung sollten in seiner Gemeinde künftig alle Kinder an einer festlichen „Tauferinnerungsfeier” teilnehmen. Nur diejenigen, die Interesse an regelmäßigen Gottesdienstbesuchen hätten, sollten auf die Erstkommunion vorbereitet werden. Bei den Eltern sei die Idee allerdings gar nicht gut angekommen, gibt der Pastor zu. Viele klagten, dass doch auch andere Pfarrgemeinden die althergebrachte Feier beibehielten. Auch in der Kirchenhierarchie stieß der Vorstoß auf Skepsis. Letztlich, so Fischer, seien sich die Kirchen fern stehenden und die Kirchen verantwortlichen ähnlich: „Die einen wollen nicht die Tradition und die anderen nicht die Hoffnung aufgeben.”
Gottesdienstsprache in ungarndeutschen Gemeinden
Sowohl in katholischen als auch in protestantischen ungarndeutschen Kirchengemeinden ist es eine Frage, in welcher Sprache das heilige Wort Jesu verkündet werden soll. Sei diese Sprache nun gemischt oder rein.

Michael Föhlingsdorf, Lajos Káposzta